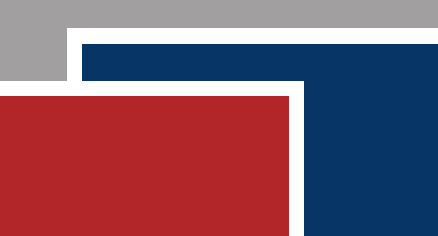Die deutsche Wirtschaft bleibt angespannt: Im Juli 2025 lag die Inflation bei +2,0 %, während Energiepreise um –3,4 % sanken und Dienstleistungen um +3,1 % zulegten. Die Arbeitslosigkeit stieg auf rund 2,98 Millionen Menschen, das sind 171 000 mehr als im Vorjahr. Während einige Institute für 2025 ein moderates Wachstum von 0,3–0,4 % erwarten, rechnet der Sachverständigenrat mit Stagnation. Zusätzlich tritt zum 1. September 2025 eine wichtige Änderung im Bundes-Immissionsschutzgesetz in Kraft: Erneuerbare Kraftstoffe, bei deren Herstellung keine Vor-Ort-Kontrollen möglich sind, können nicht mehr auf die gesetzliche Treibhausgasminderungs-Quote angerechnet werden. Unternehmen müssen künftig strengere Nachweis- und Dokumentationspflichten erfüllen.
Liebe Mandantinnen und Mandanten,
liebe Leserinnen und Leser,
I. Aktuelles
Der Bundesrat hat am 11. Juli 2025 dem Gesetz zur Umsetzung der novellierten Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III zugestimmt. Mit dem neuen Gesetz sollen der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt, Planungs- und Genehmigungsverfahren vereinfacht und gleichzeitig Umweltbelange gewahrt werden. Es überführt zentrale Inhalte der überarbeiteten EU-Richtlinie 2018/2001 in nationales Recht und beinhaltet unter anderem Änderungen am Bundesimmissionsschutzgesetz und am Wasserhaushaltsgesetz. Ein zentrales Element ist die Einführung sogenannter Beschleunigungsgebiete für Windenergieanlagen an Land, inklusive zugehöriger
Energiespeicher. In diesen Gebieten sollen Projekte künftig digital, pragmatisch und mit weniger Bürokratie genehmigt werden. Damit schafft das Gesetz auch eine Anschlussregelung an die zum 30. Juni 2025 ausgelaufene EU-Notfall-Verordnung. Darüber hinaus werden auch außerhalb dieser Zonen Genehmigungsverfahren für alle erneuerbaren Technologien – wie Wind, Solar, Geothermie und Wärmepumpen – erleichtert. Das Gesetz, das unter Mitwirkung des Umwelt-, Wirtschafts- und Bauministeriums entstanden ist, tritt unmittelbar nach seiner Verkündung in Kraft.
FFW wächst – neuer Standort Hannover
Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass die FFW Familie wächst. Neben den Standorten Berlin, Köln, Karlsruhe, München und Hamburg kommt nun der Standort Hannover hinzu.
II. Entscheidungen im Überblick
LG Frankfurt (Oder), 11.08.2025 – 31 O 38/23
In diesem Fall hat FFW erfolgreich für ein Bauunternehmen (Auftraggeber und Klägerin) gegen dessen Auftragnehmer (Beklagter) den Ersatz von Kosten für den Rückbau zweier Baustraßen erstritten. Der Auftragnehmer hatte Recyclingmaterial eingebaut, das nach späteren Untersuchungen Schadstoffbelastungen aufwies und sogar Asbest enthielt. Behörden stuften das Material daher als unzulässig für den offenen Einbau ein und forderten dessen Entfernung. Da der Auftragnehmer jede Nachbesserung verweigerte, ließ der Auftraggeber die Straßen auf eigene Kosten zurückbauen und entsorgen.
Das Gericht stellte klar, dass der Auftraggeber Mängel auch dann auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen darf, wenn keine Abnahme erfolgt ist, sofern der Auftragnehmer die Leistung für fertiggestellt ansieht, der Auftraggeber die Abnahme bestimmt und endgültig verweigert sowie der Auftragnehmer die Nachbesserung endgültig ablehnt. Ansonsten wäre der Auftraggeber gezwungen, eine mangelhafte Leistung abzunehmen.
Generell hat vor Abnahme der Auftragnehmer die Mangelfreiheit seiner Leistungen zu beweisen und dies gilt auch dann, wenn ein Auftraggeber vor der Abnahme Mängelansprüche geltend macht– diesen Nachweis konnte hier der Auftragnehmer nicht führen. Die Untersuchungen belegten vielmehr erhebliche Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte.
Die vom Auftraggeber geltend gemachten Kosten der Ersatzvornahme wurden in vollem Umfang zugesprochen. Das Gericht sah keinen Anlass, ein weiteres Sachverständigengutachten einzuholen. Stattdessen konnte es die Erforderlichkeit und Höhe der Kosten nach § 287 ZPO im Wege der Schätzung beurteilen, gestützt auf die vorgelegten Fremdrechnungen, Wiegescheine und eine plausible Darstellung des eigenen Personaleinsatzes. Auch ein Gemeinkostenzuschlag wurde als branchenüblich anerkannt.
Der Fall zeigt, dass Auftragnehmer bei der Verwendung von Recyclingmaterialien die volle Verantwortung für deren Unbedenklichkeit tragen. Verweigern sie die Nachbesserung, können Auftraggeber die Mängel selbst beseitigen und die dadurch entstandenen Kosten – auch ohne gesonderten Sachverständigenbeweis – in voller Höhe ersetzt verlangen.
OLG Brandenburg, 19.09.2024 – 5 U 140/23
In einem Nachbarschaftsstreit vor dem Landgericht Potsdam ging es um mehrere Aspekte des nachbarschaftlichen Zusammenlebens: eine zu hohe Thujahecke, Überwuchs auf das Nachbargrundstück, ein Trampolin mit Einsichtmöglichkeit, Lichtimmissionen aus Badezimmerfenstern sowie allgemeine Beeinträchtigungen der Privatsphäre. Die Kläger forderten unter anderem die Kürzung der Hecke, Entfernung oder Versetzung des Trampolins und Maßnahmen gegen Einblicke und Lichtbelästigung. Das Landgericht wies die Klage zunächst vollständig ab, wogegen die Kläger Berufung einlegten.
Das Brandenburgische Oberlandesgericht gab der Berufung teilweise statt. Einzig beim Standort des Trampolins hatten die Kläger Erfolg: Das Trampolin überschreitet mit einer Höhe von 2,80 Metern die in § 27 BbgNRG festgelegte Grenze für grenznahe, nicht dauerhaft errichtete Anlagen und muss daher einen Mindestabstand von 1,80 Metern zur Grundstücksgrenze einhalten. Es ist zu versetzen. Einen Anspruch auf vollständige Entfernung oder ein Verbot der Nutzung sah das Gericht dagegen nicht. Die sportliche Nutzung des Trampolins sei sozialadäquat und stelle – auch bei gelegentlicher Einsichtnahme – keine gezielte Verletzung der Privatsphäre dar.
Hinsichtlich der Hecke sah das Gericht keinen Anspruch auf Kürzung. Zwar überschritt sie zeitweise die zulässige Höhe von 2 Metern, jedoch wurde dies nicht rechtzeitig gerügt, weshalb der Rückschnittanspruch gemäß § 40 BbgNRG verjährt sei. Zudem sei die Hecke inzwischen auf etwa 1,90 Meter reduziert und werde regelmäßig gepflegt. Auch Überwuchs konnten die Kläger nicht konkret belegen – eine allgemeine Behauptung reiche für einen Beseitigungsanspruch nicht aus.
Die weiteren Klagepunkte wurden ebenfalls abgewiesen. Lichteinwirkungen aus Badezimmerfenstern seien als unwesentlich einzustufen und in einem innerstädtisch bebauten Wohngebiet zumutbar. Die Kläger hätten selbst Möglichkeiten, sich durch Vorhänge oder Sichtschutz vor Einblicken und Licht zu schützen. Ein Anspruch auf bauliche Änderungen der Nachbarn bestehe nicht. Auch ein Verstoß gegen das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme (§ 1 BbgNRG) liege nicht vor, da die Nutzungen nicht über das Maß des sozial Üblichen hinausgehen.
Insgesamt betonte das Gericht die Bedeutung eines gewissen Maßes an gegenseitiger Toleranz und Rücksichtnahme im nachbarschaftlichen Verhältnis. Geringfügige Beeinträchtigungen – insbesondere wenn sie nicht gezielt oder dauerhaft erfolgen – seien grundsätzlich hinzunehmen.
III. Entscheidung im Detail
BGH, Beschluss vom 15. Juli 2025 – EnVR 1/24
1. Sachverhalt
Die Antragstellerin betreibt Batteriespeicheranlagen im gesamten Bundesgebiet. Die weitere Beteiligte ist Betreiberin eines Elektrizitätsverteilernetzes. Im Mai 2021 beantragte die Antragstellerin bei der Netzbetreiberin den Anschluss eines Batteriespeichers mit einer maximalen Lade- und Entladeleistung von 1.725 Kilowatt sowie einer Speicherkapazität von 3.450 Kilowattstunden. Der Speicher sollte ausschließlich netzgekoppelt betrieben werden, ein Eigenverbrauch der gespeicherten Energie vor Ort war nicht vorgesehen.
Die Netzbetreiberin benannte einen Netzverknüpfungspunkt und forderte einen Baukostenzuschuss. Die Höhe dieses Zuschusses berechnete sie nach dem Leistungspreismodell unter Bezugnahme auf das Positionspapier der Bundesnetzagentur zur Erhebung von Baukostenzuschüssen bei Netzebenen oberhalb der Niederspannung aus dem Jahr 2009 (BK6p-06-003).
Mit Schreiben vom 20. Juni 2022 beantragte die Antragstellerin bei der Bundesnetzagentur, der Netzbetreiberin die Erhebung eines Baukostenzuschusses dem Grunde nach, hilfsweise in der konkret berechneten Höhe, gemäß § 31 EnWG zu untersagen. Die Bundesnetzagentur lehnte den Antrag mit Beschluss vom 6. Dezember 2022 ab.
Daraufhin legte die Antragstellerin Beschwerde ein. Das Beschwerdegericht hob mit Beschluss vom 20. Dezember 2023 die Entscheidung der Bundesnetzagentur auf und verpflichtete sie, über den Antrag neu zu entscheiden. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Bundesnetzagentur nun mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
2. Entscheidung
Der Bundesgerichtshof hat den Beschluss des Beschwerdegerichts aufgehoben und die Beschwerde der Antragstellerin zurückgewiesen. Nach seiner Auffassung hat das Beschwerdegericht rechtsfehlerhaft angenommen, dass die Erhebung eines Baukostenzuschusses nach dem sogenannten Leistungspreismodell für rein netzgekoppelte Batteriespeicher gegen das Diskriminierungsverbot des § 17 Abs. 1 Satz 1 EnWG verstoße.
Zwar unterscheiden sich Batteriespeicher in ihrer Funktion deutlich von klassischen Letztverbrauchern: Sie verbrauchen den aus dem Netz entnommenen Strom nicht unmittelbar, sondern speichern ihn zwischen, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das Netz einzuspeisen. Dies kann grundsätzlich eine netzdienliche Wirkung entfalten – etwa durch bedarfsgerechte Einspeisung bei Engpässen. Auch kann die Anwendung des Leistungspreismodells auf Batteriespeicher zu einer stärkeren Standortlenkung führen als bei anderen Verbrauchern, da sich die Höhe des Baukostenzuschusses unmittelbar an der beantragten Entnahmeleistung orientiert.
Trotz dieser Besonderheiten ist nach Ansicht des BGH eine Gleichbehandlung von Batteriespeichern mit anderen Letztverbrauchern beim Baukostenzuschuss gerechtfertigt. Maßgeblich ist der Zweck des Baukostenzuschusses: Er dient dazu, Netzanschlusskosten verursachergerecht zuzuordnen und einen übermäßigen Netzausbau zu verhindern. Je höher die vom Anschlussnehmer beantragte Leistung, desto umfangreicher müssen die Netzkapazitäten vorgehalten werden – unabhängig davon, ob der Strom sofort verbraucht oder zwischenzeitlich gespeichert wird. In dieser Hinsicht sind Batteriespeicher hinsichtlich ihrer Netzanschlussbedarfe mit anderen Letztverbrauchern vergleichbar.
Zudem unterstützt der Zuschuss eine verursachungsgerechte Finanzierung des Netzausbaus. Die Netzbetreiber sollen durch das Leistungspreismodell Anreize setzen können, damit Anschlussnehmer ihre Leistung möglichst realitätsnah dimensionieren. Das schützt das Gesamtsystem vor Überkapazitäten und verteilt die Kosten gerecht auf die Verursacher. Dieser Lenkungszweck besteht auch bei Batteriespeichern, da sie das Netz durch Stromentnahme belasten, unabhängig davon, ob sie später wieder einspeisen.
Auch die mögliche netzdienliche Funktion von Batteriespeichern rechtfertigt keine abweichende Behandlung. Zwar können solche Speicher dazu beitragen, Netzengpässe zu reduzieren oder Lastspitzen auszugleichen. Diese Wirkungen betreffen jedoch nicht zwangsläufig das lokale Verteilnetz, für das der Baukostenzuschuss erhoben wird. Vielmehr können netzdienliche Effekte auch regional oder überregional wirksam werden. Daher ist es nicht Aufgabe der Antragstellerin, sondern des Netzbetreibers zu beurteilen, ob und unter welchen Umständen ein konkreter Batteriespeicherbetrieb netzentlastend wirkt. Es liegt im Entscheidungsspielraum des Netzbetreibers, generalisierende und diskriminierungsfreie Kriterien für die Erhebung von Baukostenzuschüssen zu entwickeln. Die Orientierung am Positionspapier der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2009 ist in diesem Zusammenhang rechtlich zulässig.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdegerichts ergibt sich auch aus europarechtlichen Vorschriften kein unmittelbares Verbot der Erhebung von Baukostenzuschüssen für Speicheranlagen. Die einschlägigen Regelungen der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (EU) 2019/944 und der Verordnung (EU) 2019/943 enthalten zwar Zielvorgaben, die einen erleichterten Zugang von Speicheranlagen zum Netz anstreben. Diese sind jedoch nicht als absolute Verbote ausgestaltet, sondern stehen im Kontext anderer Ziele, wie etwa der Kostentragungsgerechtigkeit für Haushaltskunden. Die Mitgliedstaaten haben insoweit Umsetzungsspielräume, innerhalb derer auch wirtschaftliche Belastungen einzelner Gruppen – wie etwa Netzbetreiber oder Netznutzer – berücksichtigt werden dürfen.
Hinzu kommt, dass Batteriespeicher in Deutschland bereits in vielfältiger Weise gefördert werden, beispielsweise durch Befreiungen von Netzentgelten oder steuerliche Vorteile. Eine zusätzliche Entlastung durch Verzicht auf Baukostenzuschüsse wäre nur möglich, wenn die damit verbundenen Kosten auf die Gemeinschaft der Netznutzer umgelegt würden. Dies würde zu einer finanziellen Belastung der Allgemeinheit führen, während der wirtschaftliche Nutzen – etwa durch Arbitragegewinne an Strombörsen – allein dem Betreiber der Speicheranlage zufließen würde.
Vor diesem Hintergrund hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Bundesnetzagentur zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Erhebung eines Baukostenzuschusses nach dem Leistungspreismodell mit dem Diskriminierungsverbot des § 17 EnWG vereinbar ist. Eine Ungleichbehandlung von Batteriespeichern ist weder geboten noch europarechtlich vorgeschrieben.