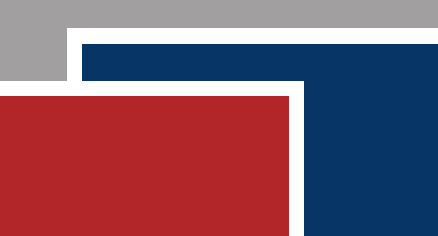Liebe Mandantinnen und Mandanten,
liebe Leserinnen und Leser,
mit der Depesche Oktober 2025 möchten wir Sie wieder über aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung informieren.
I. Aktuelles
1. BGH, Urteil vom 30. September 2025 - II ZR 154/23
Im Juni 2021 schloss die Volkswagen AG Haftungsvergleiche mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden sowie einem weiteren ehemaligen Vorstandsmitglied. In diesem Zusammenhang wurde ein Deckungsvergleich mit D&O-Versicherern zur abschließenden Regelung potenzieller Schadensersatz- und Deckungsansprüche vereinbart.
Die Vergleiche stützten sich auf einen Untersuchungsbericht sowie Prüfungen, auf deren Grundlage die Volkswagen AG zu dem Schluss gelangte, dass die beiden ehemaligen Vorstandsmitglieder im Zusammenhang mit dem sog. „Dieselskandal“ ihre Sorgfaltspflichten fahrlässig verletzt hatten. Trotz vorhandener Hinweise auf den Einsatz unzulässiger Softwarefunktionen in Dieselmotoren hätten die Vorstandsmitglieder keinen Anlass für eine unverzügliche Aufklärung gesehen.
Die Vergleiche sahen von den ehemaligen Vorstandsmitgliedern persönlich zu leistende Beträge in Höhe von 11,2 Mio. EUR bzw. 4,1 Mio. EUR sowie Leistungen der D&O-Versicherer in Höhe von insgesamt rund 270 Mio. EUR vor. Im Gegenzug verpflichtete sich die Volkswagen AG, die beiden früheren Vorstandsmitglieder von bestimmten Ansprüchen Dritter freizustellen, die im Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Sachverhalt gegen diese geltend gemacht werden könnten.
Im Rahmen des Deckungsvergleichs sagte die Volkswagen AG zudem zu, bestimmte weitere Personen – darunter sämtliche aktuelle und ehemalige Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates – dauerhaft nicht in Anspruch zu nehmen.
Der BGH hat den Hauptversammlungsbeschluss über die Zustimmung zum sog. Deckungsvergleich mit den D&O-Versicherern für nichtig erklärt. Der BGH hat festgestellt, dass sich aus der in der Einberufung der Hauptversammlung angegebenen Tagesordnung nicht hinreichend klar ergeben hat, dass mit dem Vergleich ein umfassender Verzicht auf etwaige Schadensersatzansprüche gegenüber sämtlichen amtierenden und ehemaligen Organmitgliedern der Volkswagen AG verbunden gewesen ist. Die Aktionäre sind insoweit nicht ausreichend über die Folgen ihrer Zustimmung informiert worden, sodass eine Verletzung des Informations- und Transparenzgebotes vorgelegen hat.
Entgegen der Auffassung der Berufungsinstanz (OLG Celle) sind die Beschlüsse bzgl. der Haftungsvergleiche anfechtbar. Nach Auffassung des BGH ist eine umfassende Auskunft über die Vermögensverhältnisse der ehemaligen Vorstandsmitglieder für die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Entscheidung über die Zustimmung zu den Haftungsvergleichen von wesentlicher Bedeutung. Informationen zur Vermögenssituation der betroffenen früheren Vorstandsmitglieder sind zumindest insoweit erforderlich gewesen, um eine sachgerechte Entscheidung über die Zustimmung zu den Haftungsvergleichen treffen zu können.
Der BGH hat anhand der Feststellungen des OLG Celle nicht mit der gebotenen Sicherheit beurteilen können, ob die Aktionäre vor ihrer Entscheidung ausreichend informiert worden sind. Deshalb hat der BGH den Rechtsstreit in diesem Punkt zur erneuten Verhandlung an das OLG Celle zurückverwiesen.
Der BGH hat mit der Entscheidung die Anforderungen an die Informationspflichten im Rahmen der Einberufung einer Hauptversammlung verschärft und damit die Rechte der Aktionäre deutlich gestärkt.
2. Bau-Turbo
Der sog. „Bau-Turbo“ der Bundesregierung hat auch die Zustimmung des Bundesrates erhalten und kann somit in Kraft treten.
Durch das Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaues und zur Wohnraumsicherung wurde § 246e in das BauGB eingeführt.
Im Rahmen dieses Sondertatbestandes erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen von den regulären Anforderungen des Bauplanungsrechtes abzuweichen. Insbesondere kann dadurch die Schaffung von Wohnraum ohne die vorherige Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes zugelassen werden. Dies betrifft u. a. Maßnahmen der Nachverdichtung im Innenbereich – wie etwa Aufstockungen, Anbauten oder das Bauen in zweiter Reihe.
Darüber hinaus sieht die Regelung verkürzte Fristen für Genehmigungsverfahren vor.
Zudem kann von den Vorgaben des Immissionsschutzrechtes, etwa bei Wohnbebauung in der Nähe gewerblicher Nutzungen, abgewichen werden.
Beschließt eine Gemeinde, von der Regelung des § 246e BauGB Gebrauch zu machen, ist der Bauantrag innerhalb von drei Monaten nach seinem Eingang bei der zuständigen Genehmigungsbehörde zu bescheiden. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung, tritt die Genehmigungsfiktion ein; der Bauantrag gilt mithin als genehmigt.
Die kommunale Planungshoheit bleibt unberührt, da die Anwendung des Bau-Turbos ausschließlich mit Zustimmung der jeweiligen Gemeinde erfolgen kann.
II. Urteile im Überblick
BGH, Urteil vom 6. August 2025 – VIII ZR 250/23
Die kalte Jahreszeit bringt regelmäßig rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Räum- und Streupflicht auf Gehwegen und gemeinschaftlich genutzten Flächen mit sich. Von besonderer praktischer Relevanz ist dabei die Frage, in welchem Umfang ein Vermieter – insbesondere in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft – gegenüber seinen Mietern zur Verkehrssicherung verpflichtet ist.
Mit Urteil vom 6. August 2025 – VIII ZR 250/23 hatte der BGH über die Haftung eines vermietenden Wohnungseigentümers zu befinden, nachdem eine Mieterin auf einem nicht geräumten, gemeinschaftlich genutzten Weg des Grundstücks zu Fall gekommen war. Gegenstand der Entscheidung waren insbesondere die Reichweite der dem Vermieter obliegenden Verkehrssicherungspflichten als vertragliche Nebenpflicht i. S. d. § 241 Abs. 2 BGB, die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Delegation der Winterdienstpflicht sowie die Zurechnung des Verhaltens Dritter nach § 278 BGB.
Die Klägerin ist Mieterin einer Eigentumswohnung der Beklagten in einem Mehrfamilienhaus. Der Winterdienst für die Wege auf dem Grundstück wird von einer GmbH durchgeführt, die im Auftrag der Wohnungseigentümergemeinschaft als professioneller Hausmeisterdienst tätig ist.
Im Januar 2017 stürzte die Klägerin beim Verlassen des Hauses auf dem Zugangsweg, der nicht von Eis befreit war. Infolge des Sturzes erlitt die Klägerin erhebliche Verletzungen.
Das AG Wetzlar hat der Klage, die u. a. auf die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes gerichtet war, in Höhe von 12.000 EUR stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das LG Limburg das Urteil abgeändert und die Klage insgesamt abgewiesen. Nach Auffassung des LG Limburg führt die Übertragung der Räum- und Streupflicht im Winter von der Wohnungseigentümergemeinschaft auf einen professionellen Hausmeisterdienst dazu, dass eine Haftung des Vermieters nur dann in Betracht komme, wenn dieser seine Überwachungs- und Kontrollpflichten gegenüber dem beauftragten Unternehmen verletzt habe. Dies sei vorliegend nicht ersichtlich.
Mit Urteil vom 6. August 2025 – VIII ZR 250/23 hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das LG Limburg zurückverwiesen.
Der BGH hat klargestellt, dass das LG Limburg nicht ausreichend berücksichtigt hat, dass die Beklagte aus dem Mietvertrag verpflichtet ist, während der Wintermonate die auf dem Grundstück der vermieteten Wohnung befindlichen Wege zu räumen und zu streuen. Diese mietvertragliche Verpflichtung zur Verkehrssicherung besteht auch dann, wenn der Vermieter – wie hier – lediglich Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft und nicht Alleineigentümer des Grundstückes ist.
Die abweichende Auffassung des LG Limburg überzeugt den BGH nicht, da diese eine sachlich unbegründete Ungleichbehandlung im Schutzniveau des Wohnraummietrechtes begründet und einer tragfähigen rechtlichen Grundlage entbehrt.
Etwas anderes gilt nur, wenn die Parteien eine von der üblichen Verteilung der vertraglichen Pflichten abweichende Vereinbarung getroffen haben. Dem Mietvertrag ist im vorliegenden Fall eine derartige Vereinbarung nicht zu entnehmen.
Nach Auffassung des BGH führt die Übertragung der Verkehrssicherungspflichten auf einen Dritten nicht zu einer Entlastung des Vermieters von seiner vertraglichen Haftung. Weder Art noch Umfang der ihn treffenden Pflichten werden durch eine solche Delegation berührt. Insbesondere beschränkt sich die Verantwortung des Vermieters nicht auf bloße Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen.
Zur Erfüllung ihrer mietvertraglichen Verpflichtung zur Schnee- und Eisbeseitigung ist es der Beklagten grundsätzlich gestattet gewesen, die mit dem Winterdienst beauftragte GmbH als Erfüllungsgehilfin i. S. d. § 278 Satz 1 BGB einzusetzen. Ein etwaiges Verschulden der GmbH ist der Beklagten daher gem. § 278 BGB wie eigenes Verschulden zuzurechnen.
Mit der Entscheidung schafft der BGH Klarheit über die Reichweite der Verkehrssicherungspflichten des vermietenden Wohnungseigentümers im Bereich des Sondereigentums innerhalb einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Die Haftung des Vermieters wird durch die Einbindung in die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer nicht eingeschränkt. Vielmehr stellt der BGH klar, dass die mietvertraglichen Verkehrssicherungspflichten unabhängig von der eigentumsrechtlichen Struktur bestehen bleiben.
Damit stärkt und vereinheitlicht der BGH die Haftungssystematik im Wohnraummietrecht bei vermietetem Wohnungseigentum.
III. Urteil im Detail
OLG Köln, Urteil vom 17. September 2025 – 11 U 125/23
1. Sachverhalt
Die Klägerin beauftragte die Beklagte am 15. September 2017 mit der Ausführung von Dachdeckerarbeiten. Die Vergütung wurde auf Grundlage der voraussichtlich zu leistenden Arbeitsstunden berechnet.
Mit Schreiben vom 27. September 2017 forderte die Beklagte die Klägerin zur Stellung einer Sicherheit gemäß § 650f BGB in Höhe von 20.000,00 EUR zzgl. 10 % Nebenkosten bis zum 05. Oktober 2017 auf. Die Höhe der verlangten Sicherheit wurde nicht näher begründet und überstieg die im Vertrag festgelegten Angaben zur Vergütung.
Am 28. September 2017 beglich die Klägerin die erste Abschlagsrechnung durch Zahlung von 7.013,33 EUR.
Mit E-Mail vom 28. September 2017 beanstandete die Klägerin, dass die von der Beklagten geforderte Sicherheit nicht nachvollziehbar und überhöht sei, und bot stattdessen die Hinterlegung von 3.500,00 EUR auf einem Notaranderkonto an.
Da die Klägerin die geforderte Sicherheit in Höhe von 20.000,00 EUR nicht stellte, kündigte die Beklagte den Werkvertrag wegen nicht gestellter Sicherheit am 18. Oktober 2017.
In dem Verfahren vor dem LG Aachen haben die Parteien u. a. über einen Werklohnanspruch der Beklagten für nicht erbrachte Leistungen gestritten. Entscheidungsrelevant ist dabei insbesondere die Frage gewesen, ob die Kündigung der Beklagten wegen der nicht gestellten Sicherheit wirksam erfolgt ist.
Das LG Aachen hat mit Urteil vom 6. November 2023 – 7 O 127/18 den Werklohnanspruch der Beklagten für nicht erbrachte Leistungen abgelehnt. Nach Auffassung des LG Aachen lägen die Voraussetzungen für eine wirksame Kündigung wegen nicht gestellter Sicherheit nicht vor, da das Sicherungsverlangen der Beklagten als nicht nachvollziehbar und überhöht anzusehen sei.
Im Rahmen des Berufungsverfahrens hat sich auch das OLG Köln mit den rechtlichen Voraussetzungen einer Kündigung nach § 650f Abs. 5 S. 1 BGB befasst.
2. Entscheidung
Das OLG Köln schließt sich der Auffassung des LG Aachen hinsichtlich der Unwirksamkeit der Kündigung an und bestätigt damit die Ablehnung eines Werklohnanspruches der Beklagten für nicht erbrachte Leistungen gem. § 650f Abs. 5 S. 2 BGB. Im Einzelnen dazu:
Eine wirksame Kündigung wegen nicht geleisteter Sicherheit nach § 650f Abs. 5 S. 1 BGB setzt voraus, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit gesetzt hat. Dabei hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber in der Regel die Höhe der geforderten Sicherheit mitzuteilen.
Bei der Ermittlung der Höhe des Anspruches auf Sicherheitsleistung ist grundsätzlich die im Vertrag vereinbarte Vergütung als Ausgangspunkt zu nehmen. Dies gilt auch, wenn die Abrechnung auf Stundenlohnbasis erfolgt.
Ist die vereinbarte Vergütungshöhe unklar oder möchte der Auftragnehmer hiervon deutlich abweichen, muss der Auftragnehmer für den Auftraggeber die Ermittlung der Anspruchshöhe auf Sicherheitsleistung plausibel und nachvollziehbar begründen.
Dabei ist zu beachten, dass eine Forderung des Auftragnehmers nach einer überhöhten Sicherheit nicht automatisch zur Unwirksamkeit des Sicherungsverlangens führt. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer vielmehr eine angemessene Sicherheit in einer für ihn feststellbaren Höhe anbieten. Lehnt der Auftragnehmer die angebotene
Sicherheit ab oder reagiert nicht darauf, wird das Sicherungsverlangen unwirksam. In diesem Fall stehen dem Auftragnehmer die Rechte aus § 650f BGB nicht zu.
Da die Beklagte trotz Rüge und Angebot der Klägerin die geforderte Sicherheitshöhe nicht dargelegt hat, ist nach Auffassung des OLG Köln die Fristsetzung in Verbindung mit dem nicht ausreichend begründeten Sicherungsverlangen nicht geeignet, die Rechte gem. § 650f BGB zu begründen.
Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das OLG Köln hat die Revision zugelassen. Die Zulassung der Revision durch den Bundesgerichtshof eröffnet die Möglichkeit einer umfassenden rechtlichen Prüfung der Voraussetzungen für eine wirksame Kündigung nach § 650f Abs. 5 S. 1 BGB aufgrund nicht gestellter Sicherheit. Insbesondere wird der BGH voraussichtlich klären, in welchem Umfang und mit welcher Nachvollziehbarkeit die Höhe der Sicherheitsleistung zu begründen ist.
Die Entscheidung des BGH könnte für zukünftige Werkverträge wichtige Leitlinien hinsichtlich der Sicherungsforderungen und Kündigungsrechte liefern und damit für mehr Rechtssicherheit in Bau- und Werkvertragsangelegenheiten sorgen.